Die Vorstandsmitglieder und Fachgruppenvorsitzenden des DKV stellen im Folgenden ihre persönliche Sicht auf die anstehende GEMA-Reform vor.
Als genreübergreifender Verband möchten wir hiermit das Meinungsspektrum zu diesem wichtigen Thema darlegen, Entscheidungshilfe geben und für einen konstruktiven Diskurs werben.
Durch Anklicken der +-Zeichen neben dem Namen wird das jeweilige Statement aufgeklappt.
Moritz Eggert (Präsident des DKV)
 Ich bin für eine Reform. Ich bin nur nicht für die Reform, die uns hier vorliegt.
Ich bin für eine Reform. Ich bin nur nicht für die Reform, die uns hier vorliegt.
Ich respektiere, dass für viele unserer Mitglieder das Angebot dieser Reform erst einmal verlockend klingt. Die GEMA gibt im Moment alles, um sie uns als ein Allheilmittel für alle Probleme zu verkaufen. Und genau das sollte uns stutzig machen. Wenn ein Emailverteiler der GEMA genutzt wird, um auf Stimmenfang zu gehen, dann ist das ein undemokratischer Missbrauch des Machtapparats der GEMA, wie es ihn noch nie gegeben hat, vor allem, da es konstruktive Alternativanträge gibt, die mit keinem Wort genannt wurden.
Wie diese Reform propagiert wurde, wie Kritik daran unterdrückt wurde, wie man versucht hat, den DKV und seine Fachgruppen dafür zu instrumentalisieren – auch das ist ohne jedes Beispiel in der Vergangenheit, und wir müssen uns daher sehr gut überlegen, wie wir als Verband in Zukunft mit solchen Situationen umgehen wollen.
Ich sehe uns als DKV in einer anderen Rolle. Wir brauchen die GEMA und wir unterstützen sie auch, aber wir müssen auch in der Lage sein, ein kritisches Gegengewicht zu bilden, auch Kontrollorgan zu sein, wenn etwas nicht rund läuft. Und das ist hier der Fall.
Wenn man den Antrag genau liest (und ich finde, dass dies jede und jeder tun sollte, um die wahren Absichten und Auswirkungen zu verstehen), dann stellt man fest, dass hier ein Präzedenzfall geschaffen werden soll, der die Macht des Aufsichtsrats massiv vergrößern soll. Es droht eine Geldverteilung, die nicht mehr transparent ist, und schlimmste Gefahren der Manipulation, der Geschäftsmodelle und der subjektiven Einflussnahme birgt. Der Teufel steckt im Detail – eine ganze Sparte (eine Sparte der GEMA, die nur 1,3% bekommt und deren Mitglieder im Schnitt 5 Jahre später ordentliche Mitglieder werden als ihre U-Kollegen) wird hier um 70-90% zusammengekürzt. Nicht nur das – sie soll auch aus den Entscheidungsprozessen innerhalb der GEMA entfernt und auf alle Zeiten marginalisiert werden. Das ist nicht „modern“ und auch nicht kollegial.
Zu den vielen Gründen gegen die Reform haben sich nicht nur ich, sondern zahllose lesende Menschen ausführlich geäußert, das muss ich hier nicht wiederholen, da der Platz hier gar nicht ausreicht, um die mindestens 100 sachlichen Argumente gegen die Reform hier aufzulisten. Worum es mir aber geht, ist die Solidarität in unserem Verband.
Seit über 40 Jahren engagiere ich mich beim DKV und besuche regelmäßig GEMA-Versammlungen. Ich weiß nicht wie oft ich aufmerksam zugehört habe, wenn es um die Belange von Sparten ging, die mich nicht persönlich betreffen. Ich habe abgestimmt, um die Rechte von Singer/Songwritern, Filmkomponierenden und auch Jingle-Komponierenden zu verteidigen. Ich habe als Vorstandsmitglied wie auch als Präsident des Verbandes die Probleme aller Sparten ernst genommen und mich dafür eingesetzt.
Meine große Sorge ist nun, dass es umgekehrt nicht so ist.
Momentan wird von vielen (gottseidank nicht allen) Kolleginnen und Kollegen komplett ignoriert, dass eine gesamte Fachgruppe mit gutem Grund geschlossen gegen einen Antrag ist und den konstruktiven Vorschlag macht, eine verbesserte Version gemeinsam zu erarbeiten. Wenn dies bei der Abstimmung komplett ignoriert werden sollte, sehe ich die grundsätzliche Solidarität unseres Verbandes in höchster Gefahr.
Solidarität und Respekt muss in alle Richtungen funktionieren, nicht nur in eine. Ich persönlich würde es sehr ernst nehmen, wenn VERSO oder DEFKOM-Mitglieder geschlossen gegen einen Antrag sind, das wäre ein Alarmsignal für mich, dringend das Gespräch darüber zu suchen. Was wir aber stattdessen bei Antrag 22a erleben ist Ausgrenzung von Kritikern, Negativpropaganda, die mit falschen Statistiken und unhaltbaren Behauptungen arbeitet, und DKV-Vorstandsmitglieder, die sich ermächtigt fühlen, die eigene Macht im DKV durch Doppelvertretung im Aufsichtsrat bis zur Neige auszukosten, Maulkörbe und Redeverbot inklusive.
Wir müssen uns fragen, ob wir wirklich wollen, dass der DKV alles abnickt, was die GEMA macht. Wenn wir das tun, machen wir die GEMA zu einer autokratischen Diktatur anstatt zu einem Verein für ALLE Mitglieder. Wir werden zu einem Instrument und hören auf, unabhängiger Interessenverband zu sein.
Ich hoffe sehr, dass ihr dies versteht, und für unsere Alternativanträge stimmt, denn dann gäbe es die reelle Chance, dass wir eine Reform hinbekommen, die wir alle mittragen können. Das ist eine gute Option und eine bessere Alternative zum gegenwärtigen „Pistole auf die Brust“ des Antrags. Ihr verhindert damit nicht, dass es eine Reform gibt, sondern ihr sorgt dafür, dass es eine BESSERE Reform gibt.
Ich hoffe auf eure Kollegialität.
Ralf Weigand (Vizepräsident des DKV)
 Gerne darf ich an dieser Stelle meine Position zur Reform rein als Komponist, Produzent und Musiker darlegen und dabei alle Hüte ablegen, die ein Teil von Euch mir durch verschiedene Wahlen aufgesetzt hat.
Gerne darf ich an dieser Stelle meine Position zur Reform rein als Komponist, Produzent und Musiker darlegen und dabei alle Hüte ablegen, die ein Teil von Euch mir durch verschiedene Wahlen aufgesetzt hat.
Vorab sei gesagt, dass ich bis heute das große Glück hatte, mit wirklich sehr vielen höchst unterschiedlichen Musikrichtungen und -formen in Kontakt zu kommen und diese meinen Möglichkeiten entsprechend verstehen zu dürfen. Dabei habe ich gelernt, jedem einzelnen Musikschaffenden in seiner jeweiligen Sphäre mit größtem Respekt zu begegnen. Ich habe fast ausschließlich wunderbare Künstlerpersönlichkeiten kennengelernt, die regelmäßig mit größter Inspiration, Fleiß und Engagement ihrer Profession nachgehen und damit zum Teil außerordentliche und herausragende Werke kreieren und realisieren! Und wie viele davon mussten jahrelang hadern und zweifeln, weil es zunächst kaum großen künstlerischen oder gar materiellen Erfolg gab, und wie sehr hat / hätte da jede Form von Unterstützung geholfen, um den steinigen Weg fortsetzen zu können.
Und genau aus dieser Position und Erfahrung generiert sich meine positive Haltung zur geplanten Reform: Nach wirklich schwierigsten Diskussionen und Abwägungen haben sich Aufsichtsrat und Vorstand der GEMA entschlossen, auch künftig ein absolut entschlossenes und mutiges Bekenntnis pro Musikkultur und pro Vielfalt abzugeben. Mit unverändert 30 % der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel, alles für reine Kulturförderung, mehr als jede andere Verwertungsgesellschaft des Planeten zur Verfügung stellt! Dies allerdings jetzt für Werke ALLER Genres, bei denen ein entsprechendes Förderbedürfnis besteht.
Natürlich kann ich die Klagen und Sorgen unserer Vertreter der derzeit hierzulande noch als E-Musik bezeichneten zeitgenössischen sog. Neuen Musik sehr gut verstehen. Es ist auf jeden Fall nicht einfach, nun – bzw. wie geplant nach 4 Jahren sorgsamer Abfederung – ein jahrzehntelang bestehendes, sehr luxuriöses Privileg mit Kolleg:innen aus anderen Genres zu teilen. Andererseits hat die GEMA eben leider viel zu lange gewartet und damit dem längst erfolgten Wandel im Musikleben unseres Landes zu wenig Rechnung getragen. Und natürlich geht mit dem neuen Modell auch die substanzielle Förderung der zeitgenössischen Kunstmusik weiter, aber eben nicht mehr exklusiv.
Umso mehr gilt es nun, nach vorne zu schauen: Der Vorschlag beinhaltet einen Prozess über 5 Jahre, bei dem in verschiedenen Stufen das Ideal der Förderung erreicht wird. Geplant ist diesmal ein agiles Vorgehen, bei dem ständig – insbesondere bzgl. der Förderkriterien und des individuellen Förderumfangs der Werke – nachjustiert und angepasst werden kann. Dies, um viel aktueller den musikkulturellen Gegebenheiten gerecht zu werden und eine unflexible, festgefahrene Situation wie jetzt zu vermeiden.
Es mag immer wieder partielle Unzufriedenheit und Kritik an der GEMA geben, aber wer sich die Entwicklung der letzten Jahre ansieht, wird auch die vielen Fortschritte bei der Modernisierung und beim sehr relevanten Beitrag zur Sicherung unserer Existenzen als Musikautor:innen registriert haben. Das gibt mir das Vertrauen in die Fähigkeit unserer Verwertungsgesellschaft, gemeinsam und in enger Abstimmung mit uns und den demokratisch gewählten Vertreter:innen auch bei der Kulturförderung einen neuen, dynamischen und letztlich allen Mitgliedern zugutekommenden Weg zu gehen!
Mit wie gesagt großem Respekt und herzlichem kollegialen Gruß an Euch alle.
Rainer Fabich (Vorstandsmitglied)
 Prinzipiell finde ich es wichtig und längst überfällig, das dicke Brett GEMA-Reform anzubohren. Es ist mehr als notwendig, bestimmte Fehlentwicklungen und Ungerechtigkeiten der letzten Jahre zu korrigieren, Privilegien auf den Prüfstand zu stellen.
Prinzipiell finde ich es wichtig und längst überfällig, das dicke Brett GEMA-Reform anzubohren. Es ist mehr als notwendig, bestimmte Fehlentwicklungen und Ungerechtigkeiten der letzten Jahre zu korrigieren, Privilegien auf den Prüfstand zu stellen.
Das jahrelang geltende, binäre und personenbezogene Dogma, einmal E-Musik-Komponist:in, immer E , bzw. einmal U-Musik-Komponist:in, immer U, dieser starre Automatismus entspricht in vielen Fällen nicht mehr der aktuellen Realität. Sei es, daß viele Personen mittlerweile in beiden Bereichen unterwegs sind, die Grenzen sprengen oder innerhalb ihrer eigenen Werke Elemente beider Polaritäten selbst implementieren. Dies hat bekanntermaßen in der gesamten Musikgeschichte schon immer Tradition.
Es kann und darf nicht sein, daß vom künstlerischer Seite vergleichbare Werke aus den Bereichen, wie z.B. E-Orchesterwerk oder U-Jazzorchesterwerk um ein vielfaches anders bewertet werden, mit allen seinen finanziellen Konsequenzen. Ähnliches gilt für viele Genres, wie z.B. Jazz, World- und Filmmusik, experimenteller Pop oder Chanson, die oft mit demselben künstlerischen Anspruch geschaffen und im Vergleich zur E-Musik bisher einfach viel zu stark benachteiligt werden. Ist etwa nur E-Musik Kunst?
Auch müssen künftig die starren Übergangsstufen in der Berechnung und Ausschüttung nun endgültig passé sein, was im Zeitalter wesentlich leichter programmierbarer Algorithmen einfacher zu realisieren sein sollte. Dies betrifft vor allem die bei der Bezahlung relevanten Parameter, wie Dauer und Besetzung und die künftig auch wesentlich leichter zu erfassenden Merkmale, wie Komplexität, Struktur, Harmonik, Melodik, Rhythmik oder etwa Instrumentierung einer Komposition.
Es kann und darf nicht sein, daß beispielsweise beim Erreichen einer bestimmten Schwelle, dann plötzlich der doppelte Betrag im Einspielergebnis erzielt werden kann.
Darüber hinaus bleiben auch sehr viele Fragen und Kritikpunkte am Reformverfahren offen, von denen ich einige mir wichtige aufgreifen will:
-
- Warum wurde diese wichtige und komplexe Reform nur in einem relativ kleinem Kreis der GEMA ersonnen, ohne daß man hohe die Fachkompetenz ihrer Mitglieder und der Verbände entweder gar nicht bzw. in viel zu geringem Maße und viel zu spät mit einbezogen hat? Hat man nicht aus den zahlreichen Fehlern der Vergangenheit, wie z.B. der Politik gelernt (Stichwort: Stuttgart 21 oder Heizungsgesetz)?
- Warum gibt man dem „Souverän“, der Mitgliederversammlung nur 6 Wochen Zeit, sich in den komplizierten „Gesetzestext“ der Änderungsvorschläge für ein derart wichtiges Thema einzuarbeiten, ohne dann im Vorfeld ausführlicher darüber diskutieren zu können?
- Was passiert, wenn man dann feststellt, daß etwas in die falsche Richtung geht, daß eine ganze Branche droht den Bach runter zu gehen, nachdem man den GEMA-Tanker auf diese fünfjährige Reise geschickt hat? Wo bleiben die Korrekturmöglichkeiten, welche Stellschrauben gibt es dann noch?
- Wie geht es weiter, was ist als nächstes geplant, z.B. in punkto Wertung, Alterssicherung oder GEMA-Sozialkasse?
- Muss es sein, dass fest angestellte, von staatlicher Seite bestens alimentierte Kolleg:innen, bisher einkommensunabhängig, in z.T. erheblichem Maße auch noch finanziell gefördert werden? Hat nicht gerade die Corona-Krise gezeigt, dass es in Deutschland defacto ein 2-Klassen-System auch im Kulturbereich gibt, die Festangestellten/Beamten und die Soloselbständigen? Wurden nicht gerade letztere, die bisher auf volles existenzielles Risiko gegangen sind, nur mit z.T. geringen Almosen abgespeist, das sie später oft dann auch noch wieder zurückzahlen mußten? Beamte hingegen haben dagegen ihr Gehalt voll weiterbezahlt bekommen und ohne Bedürftigkeitsprüfung automatisch ein zusätzliches Monatsgehalt erhalten. Sollte dieses Faktum bei einer Förderung nicht künftig auch berücksichtigt werden?
- Fördert nicht ein Jury basiertes, wertendes Fördersystem wieder zahlreiche Abhängigkeiten, eine „Spezlwirtschaft“, die dann auch noch, je nach Lage, die Einhaltung bestimmter politischer oder ideologischer Dogmen für eine Förderung voraussetzt? Wäre es nicht besser, auf diese Dinge zu verzichten? So wie etwa aktuell gerade geschehen, im neu verabschiedeten Filmförderungsgesetz. Hier wurde gerade ein Jury unabgängiges Referenzfördersystem (Punktesystem nach bestimmten Voraussetzungen, ohne Jury) eingeführt, bei dem es erfreulicherweise nun auch eine Projektförderung für die Drehbuchautoren gibt.
- Stimmt der Vorwurf, wie manche behaupten, daß die GEMA, quasi im „vorauseilendem Gehorsam“ den mächtigen Musikkonzernen und digitalen Plattformen viel zu günstige Konditionen eingeräumt hat, dabei zu wenig Kante gezeigt hat mit der Konsequenz, daß jetzt nun zu wenig Geld in der Kasse für soziale und kulturelle Zwecke ist?
- Sollten nicht gerade jetzt, im Zeitalter der Zölle und Abschottungen allerorten, alle beteiligten Autoren und Verwertungsgesellschaften europaweit an einen Strang ziehen, sich mit zentralen und übergeordneten Themen, Problemen und Ursachen jenseits des GEMA -Tellerrands viel intensiver beschäftigen und zugleich die Politik im Lande für unsere Anliegen gewinnen, im vollen Bewußtsein der Größe unseres eigenen, europäischen Musik-Marktes?
- Gerade Frankreich hat zuletzt gezeigt, daß es doch geht, die globalen Player einzugrenzen. Dies mit seiner staatlich verordneten Re-Investionsverpflichtung in Höhe von 30-% derjenigen Erlöse, die z.B. von Netflix in Frankreich generiert werden. Die kommt allen Filmschaffenden zu gute!
Anstatt sich ängstlich wegzuducken, sich gegenseitig auch noch zu zerfleischen und dadurch den Majors zusätzlich noch in die Hände zu arbeiten, fände ich es wesentlich effektiver, diese für uns existenziellen Themen endlich mit vereinten Kräften weiter voranzubringen.
Initiativen zur Einführung einer Digitalsteuer für die bisher noch ungeschoren davon gekommenen Global Player oder aktuelle, europaweite Bestrebungen für eine faire Bezahlung im Onlinebereich gehen sicher in die richtige Richtung.
In diesem Sinne packen wir es an!
Johannes K. Hildebrandt (Vorstandsmitglied)
 Über die Trennung von E und U Musik in der GEMA und die Arten der Verteilung und Förderung kann man diskutieren. Die nun jedoch beantragte Reform stellt einen fundamentalen Paradigmenwechsel in der GEMA dar. Die Reform greift in einer noch nie dagewesenen Breite und Tiefe in das System ein.
Über die Trennung von E und U Musik in der GEMA und die Arten der Verteilung und Förderung kann man diskutieren. Die nun jedoch beantragte Reform stellt einen fundamentalen Paradigmenwechsel in der GEMA dar. Die Reform greift in einer noch nie dagewesenen Breite und Tiefe in das System ein.
Die Verteilung in E erfolgt bisher nach einem kollektiven und solidarischen Prinzip, das Nachwuchs und Mittelstand fördert. Deshalb schätze ich sie.
Das Bewusstsein der kollegialen Quersubventionierung für eine Musik, die als kulturell wertvoll und schützenswert erachtet wird, die nicht den üblichen Marktmechanismen einer kommerziell ausgerichteten Musik unterliegt gehört zu den Fundamenten der GEMA. Dieses musikalische Spektrum hat sich aber erweitert, braucht Öffnung und neue Definitionen, aber kein Festhalten nur unter anderen Namen und mit höchst einseitiger Mittelreduktion.
Altersgrenzen für Förderung halte ich für verfehlt, beginnt doch für viele erst spät und nach langer Ausbildung die eigentliche Entwicklung. Entwicklungs- und Wandlungsmöglichkeit von schöpferischer Arbeit wirken lebenslang und immer wieder neu.
Viele E-Kolleg:innen haben sich zur Reform geäußert. Ich kann leider nicht erkennen, dass wesentliche Wünsche und konstruktive Vorschläge berücksichtigt wurden. Unter der Einbeziehung der Betroffenen, transparentem Informationsfluss zur Meinungsbildung in einem offenen und konstruktiven Dialog stelle ich mir etwas anderes vor.
Den vorliegenden Reformantrag kann ich so nicht unterstützen. In zu vielen Punkten bleibt er unklar und nicht zu Ende gedacht. Beispiele, die extrem reduzierte Mittelzuweisung finde ich nicht akzeptabel, das „Werk“ findet zu wenig Berücksichtigung, die Privilegierung der „Spielstätte“ als Kriterium zur Bewertung finde ich bedenklich und es fehlen konkrete Modellrechnungen.
Die Wertung E hat Stärken und Schwächen, aber das gleiche gilt für die Wertung U. Diese Reform ist mir zu einseitig. Ich plädiere für einen Neustart, für eine offene Diskussion auf Augenhöhe. Wenn Reform, dann nur von der Breite der Mitglieder unter Achtung der Minderheiten im Sinne einer solidarischen GEMA getragen und zu ihrem Wohl ausgerichtet.
Der DKV sollte in diesem Prozess als aktiver Vermittler wirken und die nötige Diskussion anführen.
Micki Meuser (Vorstandsmitglied)
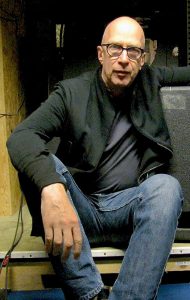 Das Reformvorhaben der GEMA wird leider überwiegend emotional diskutiert. Wie in der heutigen Zeit üblich, gibt es mehr Meinungen als Faktenwissen. Diese Meinungen werden dafür umso breiter kommuniziert. Das Resultat ist Verunsicherung und allgemeine Skepsis gegenüber einer sinnvollen und notwendigen Erneuerung der GEMA, die ohne Alternative ist. Ein paar Fakten zur Reform, um mehr Sachlichkeit in die Debatte zu bringen.
Das Reformvorhaben der GEMA wird leider überwiegend emotional diskutiert. Wie in der heutigen Zeit üblich, gibt es mehr Meinungen als Faktenwissen. Diese Meinungen werden dafür umso breiter kommuniziert. Das Resultat ist Verunsicherung und allgemeine Skepsis gegenüber einer sinnvollen und notwendigen Erneuerung der GEMA, die ohne Alternative ist. Ein paar Fakten zur Reform, um mehr Sachlichkeit in die Debatte zu bringen.
Die Grundstruktur der Reform
- Die GEMA bekennt sich weiterhin zur Förderung von anspruchsvoller und künstlerisch wertvoller Musik. Die Kulturförderung in der GEMA wird in gleicher Höhe bestehen bleiben!
- Wo in der GEMA Förderung stattfindet, steht in Zukunft auch nach außen sichtbar “Förderung” drauf. Das bisherige System von undurchsichtigen Umverteilungen mit „Fördercharakter“ wird zu einer transparenten kulturellen Förderung innerhalb der GEMA.
- Die Mittel für kulturelle und soziale Zwecke bleiben in voller Höhe erhalten, da die Reform den bisherigen 10% Abzug der GEMA Mitglieder nicht antastet.
- Erhalten bleibt außerdem, dass 30% der aus diesem 10% Abzug entstehenden kulturellen Mittel (nach Abzug der Mittel für die separat finanzierte Kulturförderung Online) wie bisher zur Förderung kulturell hochwertiger Musik verwendet werden.
- Diese 30% werden als transparente Kulturförderung in einem 3-Säulenmodell verteilt: Einer ersten Säule, die überwiegend der bisherigen E-Musik zugutekommt („KUK“), einer zweiten Säule, die sich „dynamische Fokus Kulturförderung“ nennt und die nach Kriterien, die in den nächsten zwei Jahren zu finden sind, „kulturell bedeutende Musik“ aus allen Genres fördert, und einer dritten, kleineren Säule, einer „Leuchtturm-Förderung“ auf Antrag.
- Es wird die Möglichkeit geschaffen, dass nicht nur zeitgenössische „klassische” Musik gefördert wird, sondern z.B. auch gehobene Werke des Pop, Rock, Jazz oder der Filmmusik.
- Nach außen sichtbar wird die Trennung in E(rnste) und U(nterhaltungs)-Musik aufgehoben.
- Die schwer nachvollziehbare, intransparente Umverteilung in der Ausschüttung des bisherigen E-Inkassos, die eine verdeckte Förderung darstellt, wird durch eine transparente Direktverteilung und einen wirkungsvollen Ausgleich aus den Fördermitteln ersetzt.
- Erben und Rechtsnachfolger, die in der E-Wertung hohe Beträge erhalten haben, werden in Zukunft nicht mehr mit einer Förderung berücksichtigt. Es ist nicht sinnvoll, schon etablierte Werke mit hohem Inkasso auch noch zu fördern. Stattdessen wird eine wirksame Förderung gerade junger Komponist: innen etabliert. Die Reform stärkt die Schaffung neuer Werke.
- In einer klug strukturierten Zeitlinie wird der Übergang über 5 Jahre gestaltet. Während des Übergangs werden eventuelle finanzielle Verluste durch einen Übergangsfonds aufgefangen, der 90%, 75%, 50% und im letzten Jahr 25% der Mittel der bisherigen E-Wertung enthält.
- Nach dem Start der Reform gibt es zwei Jahre Zeit, eine wirksame genreübergreifende „Fokus-Förderung“ aufzubauen und durch Simulationen zu berechnen und anzupassen.
- Die bisherigen E-Komponist: innen werden mit einem generösen Punktsystem in die bisherige Wertung U übernommen, die zu einer „Allgemeinen Wertung“ für alle GEMA Mitglieder ausgebaut wird.
- Die Reform ist der notwendige und längst überfällige Schritt die Gemeinschaft der diversen Musikrichtungen in der GEMA, von Punk über Filmmusik bis zur zeitgenössischen Musik, durch eine ausgewogene und nachhaltige Verteilung zu erhalten. Die Alternative wäre das erzwungene Ende der GEMA internen Kulturförderung durch Druck von innen und außen.
- Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Status Quo der derzeit unangemessen hohen E-Wertung unabhängig davon, ob Antrag 22a angenommen wird oder nicht, juristisch nicht mehr zu halten ist. Die Nachteile für die bisherigen E-Komponist: innen wären in diesem Fall deutlich härter als der in der Reform eingeschlagene Weg.
Die Probleme des Status Quo
Es gibt zwei grundsätzliche und nicht mehr haltbare Schieflagen in der Kulturförderung der GEMA, die aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts stammen und die sich über die Jahre zu intransparenten, eine Minderheit bevorteilenden Zuständen entwickelt haben.
1.) E-Wertung
Die „E-Wertung“ transferiert erhebliche Beträge von U nach E. Davon profitiert eine Minderheit von Komponist: innen, die kaum Inkasso mit ihren Werken generieren. Zum Vergleich: Die E-Musik erhält 30 % der für die kulturelle Förderung (außer Online) zur Verfügung gestellten Mittel. Der Beitrag, den die E-Musik mit entsprechenden Abzügen und Anteilen zu den Gesamtmitteln der Wertung leistet, beträgt aber nur 3 %. In Einzelfällen sehen wir Zuschläge bei E-Komponist: innen durch die E-Wertung bis zum 10-fachen der Ausschüttung auf Verteilungsebene. Im Durchschnitt aller E-Komponist: innen liegt der Zuschlag in der E-Wertung über dem Dreifachen ihres Aufkommens. Es ist mehr als fraglich, ob eine so gravierende Privilegierung rechtlich zu halten ist.
Die Top-100 der E-Komponist: innen in der GEMA erhalten in der E-Wertung im Schnitt jedes Jahr rund 50.000 Euro an Förderung, was in etwa dem Sechsfachen der Ausschüttungssumme an diese Gruppe aus der Verteilung entspricht.
2.) Verteilung und Ausschüttung des Inkassos der E-Musik
Die Einnahmen aus dem Inkasso der E-Musik werden zwar korrekt nur an E-Komponist:innen ausgeschüttet, aber die Mittel werden durch ein Punktesystem intransparent von oben nach unten verteilt. Dies ist Förderung ohne sie Förderung zu nennen und widerspricht deutlich dem Prinzip der „Leistungsgerechtigkeit“, das die Gerichte der GEMA für die Verteilung vorgeben.
Bei beiden Punkten muss die GEMA eingreifen und tut es mit dieser Reform.
Es ist bedauerlich, dass die Komponist: innen aus ehemals E in Zukunft Verluste hinnehmen müssen, doch die derzeitigen komfortablen Zustände werden leider nicht mehr zu halten sein. Die Reform versucht diese Verluste so gering, wie juristisch möglich, zu halten.
Man kann allerdings auch mal sehen, dass seit vielen Jahrzehnten jährlich hohe Summen aus U nach E transferiert wurden und werden. Im Geschäftsjahr 2023 waren es rund 15 Mio. €, in der Vergangenheit vergleichbare Beträge.
Dies ist eine schon viele Jahre andauernde respektvolle Anerkennung der besonderen Stellung der zeitgenössischen und konzertanten Musik aus den Reihen der U-Komponist:innen. Es wird in Zukunft den E-Kolleg: innen also nichts weggenommen, was ihnen gehört. Es wird nur nicht mehr möglich sein, ihnen die Mittel aus der U-Musik in der bisherigen, intransparenten Weise unstrukturiert zukommen zu lassen. Eine solidarische Förderung soll erhalten bleiben. Sie muss und wird in Zukunft allerdings auch als Förderung sichtbar sein.
Charlotte Seither (Vorstandsmitglied)
 Die GEMA plant eine Reform zur Sparte E. Sie reagiert damit auf eine längere Entwicklung, wie auch auf erhöhten Druck von außen. Zugleich greift die Reform in historischer Tragweite in die Prozesse der Sparte E ein. Für die Komponierenden wie auch für das Kulturleben sind dabei weitreichende Folgen zu erwarten.
Die GEMA plant eine Reform zur Sparte E. Sie reagiert damit auf eine längere Entwicklung, wie auch auf erhöhten Druck von außen. Zugleich greift die Reform in historischer Tragweite in die Prozesse der Sparte E ein. Für die Komponierenden wie auch für das Kulturleben sind dabei weitreichende Folgen zu erwarten.
Eines ist klar: Für die Sparte E geht es im aktuellen Reformvorhaben um ihre Zukunft.
Eine langfristige Lösung, mit der die GEMA auch nachhaltig auf nicht-kommerzielle Schaffenswege („market-disadvantaged music areas“) reagieren kann, braucht alle Beteiligte an einem Tisch – U wie E. Nur gemeinsam können wir dafür sorgen, dass die E-Musik auch weiterhin existieren und in das kulturelle Leben in und außerhalb der GEMA ausstrahlen kann.
a) Inkasso-Prinzip
Die Ablösung der kollektiven Verteilung durch das Inkasso-Prinzip trifft die Sparte E besonders schwer. Mit ihr wird die langjährige Förderpraxis beendet, in der erfolgreiche E-Autoren andere solidarisch mitunterstützt haben. Wer nur marginale Ausschüttungen erzielen kann (z.B. in den Konzerten von Musikhochschulen), braucht lange, bis er die KUK-Zugangsschwelle überhaupt erreicht. Bereits heute partizipieren nur wenige (vorwiegend ältere) Komponierende an den kommerziell erfolgreichen Konzerten. Mit dem Inkasso-Prinzip ziehen erfolgreiche Autoren somit deutlich mehr Inkasso auf sich. Kulturelle Anerkennung – besonders in der experimentelleren Szene – und kommerzieller Erfolg klaffen in der Verteilung mitunter weit auseinander.
b) Genreneutrale Kulturförderung
Die Forderung nach einer übergreifende Kulturförderung – gemeinsam für E und U – ist das prägnanteste Zeichen der Reform. Dass kulturell bedeutende Werke auch in anderen Sparten zu finden sind, führt vielerorts zu Konsens. Kulturförderung wird dringend gebraucht, sie stützt die Komponierenden mehr als jeder andere Förderhebel. Dabei kann Kulturförderung, insbesondere für die Sparte E (KUK) nur wirken, wenn sie mit klaren Zusagen, nachhaltigen Strukturen und Mitbestimmung einher geht. Auch wenn die GEMA spartenoffen denkt, so darf die E-Musik auch langfristig nicht der Marginalisierung anheimfallen.
c) Systemische Aufhebung der Sparte E
Für die E-Musik ist das Reformvorhaben der GEMA von historischer Tragweite: In ihm werden zentrale Förderstellschrauben aufgehoben. Auch wenn die KUK-Förderung dies für den Live-Bereich aufzufangen versucht, so kann dies nur in begrenztem Radius wirksam werden. Außerhalb von KUK wird die Sparte E komplett den Verarbeitungsprozessen von U unterstellt. Damit büßt sie nicht nur ihre systemische Autonomie, sondern auch wichtige Formen ihrer politischen Selbstbestimmung ein.
Fazit: Die E-Musik verliert mit dem Reformvorhaben erhebliche Fördermittel, wichtige Strukturen und nicht zuletzt auch politische Macht. Zugleich wird sie zunehmend an den Kriterien des Marktes vermessen. Es muss also unser aller Anliegen sein, den lösungsorientierten Dialog zwischen E und U stets neu zu initiieren, um die Präsenz der E-Musik im Selbstbild der GEMA wie auch in unserer Kulturlandschaft langfristig zu sichern.
Hans P. Ströer (Vorstandsmitglied)
 Als Mitglied im Vorstand sehe ich vor allem zwei Ursachen, die uns in diese schwierige Situation geführt haben. Immer mehr Musik wird gehört und auch vergütet, das Gesamtinkasso steigt in ungeahnte Höhen. Unsere zeitgenössische E-Musik konnte mit diesem rasanten finanziellen Wachstum nicht Schritt halten.
Als Mitglied im Vorstand sehe ich vor allem zwei Ursachen, die uns in diese schwierige Situation geführt haben. Immer mehr Musik wird gehört und auch vergütet, das Gesamtinkasso steigt in ungeahnte Höhen. Unsere zeitgenössische E-Musik konnte mit diesem rasanten finanziellen Wachstum nicht Schritt halten.
Schon lange war diese Entwicklung absehbar und führt nun leider zur notwendigen Reform einer Förderung, die sich wegen einer notorisch zu fest angezogenen Stellschraube tief im Räderwerk der Statuten nicht selbst adaptiv regeln konnte.
Früher wäre es noch möglich gewesen, diese Schraube etwas zu lockern und den bestehenden Verteilungsplan mit kleineren Anpassungen sanft nachzusteuern. Doch heute geht es darum, drohenden Eingriffen von außen zuvor zu kommen, die noch weit drastischere Regulierungen zur Folge hätten.
Als leidenschaftlicher musikalischer Nomade schmerzt es mich, dass unsere zeitgenössische E-Musik nicht aus eigenem Antrieb die Grenzen ihrer Ästhetik erweitert und sich einem etwas größeren Publikum geöffnet hat, ohne dabei ihre hohen künstlerischen Ansprüche aufzugeben.
Natürlich kann eine ablehnende Haltung des Publikums nicht immer ein gültiges Indiz für schwache musikalische Qualität, ein spärlich besuchtes Konzert allein noch kein Beweis für ein kulturell unbedeutendes Werk sein. Aber ebenso sind Top-Chartpositionen allein noch kein zuverlässiger Indikator für einen besonders hohen musikalischen Substanzgehalt.
Nach meiner Auffassung ist unsere Kulturförderung in der GEMA ein notwendiger und wichtiger Eingriff in das, was passiert, wenn wir die Dinge einfach ihren Lauf nehmen lassen und allein auf den Markt vertrauen. Es geht auch um musikalische Vielfalt, um Bildungsfortschritt, um die Erweiterung von Hörerfahrungen.
Jetzt kommt es also darauf an, den Blick in die Zukunft scharf zu stellen. Denn im zweiten Teil der Reform sollen neue Förderkriterien gestaltet und festgelegt werden.
„Was ist Kultur?“, „Was ist Kunst?“, „Was ist Musik?“, „Wen und was wollen wir fördern und warum?“ – diese Fragen werden schon bald neu gestellt und mit Augenmaß beantwortet werden müssen.
Kathrin Denner (Vorstandsmitglied)
 Die geplante Reform unter Antrag 22a stellt einen tiefen Einschnitt in die bisherige Förderpraxis der GEMA dar – mit massiven Folgen für die Sparte E. Notwendige Reformen sind richtig und wichtig. Doch das vorgelegte Konzept ist weder ausgewogen noch zukunftsfähig.
Die geplante Reform unter Antrag 22a stellt einen tiefen Einschnitt in die bisherige Förderpraxis der GEMA dar – mit massiven Folgen für die Sparte E. Notwendige Reformen sind richtig und wichtig. Doch das vorgelegte Konzept ist weder ausgewogen noch zukunftsfähig.
Die bisherige kollektive Verteilung in der Sparte E beruht auf einem solidarischen Prinzip: Sie ermöglicht es auch jenen Komponist:innen, deren Werke abseits des Marktes entstehen, an Fördermitteln teilzuhaben. Dieses Prinzip soll nun durch ein individuelles Inkasso-Modell ersetzt werden – flankiert von einer neuen KUK-Förderung. Das würde bedeuten: Wer nicht ohnehin schon kommerziell erfolgreich ist, bleibt künftig in der Verteilung außen vor.
Während die bisherige E-Wertung eine tatsächliche Förderstruktur bildete, bleibt die U-Wertung ein reiner wirtschaftlicher Zuschlag – umso unverständlicher ist es, dass hier keine Reform vorgesehen ist, die diese Mittel auch als echte kulturelle Förderung nutzbar macht.
Hinzu kommt: Die geplante KUK-Förderung bleibt vage. Weder ist klar, wie viele tatsächlich davon profitieren würden, noch, wie sie ausgestaltet ist. Viele Fragen bleiben offen – unter anderem deshalb, weil belastbare Modellrechnungen fehlen. Es besteht die begründete Sorge, dass künftig nur noch eine kleine Gruppe an Fördergeldern partizipiert. Gleichzeitig würde die Sparte E weitgehend abgeschafft und in die Strukturen der U-Musik überführt – mit allen Konsequenzen für Sichtbarkeit, Einfluss und kulturpolitische Mitbestimmung.
Besonders kritisch ist, dass dieser Reformprozess ohne echte Beteiligung der betroffenen Mitglieder geführt wurde. Viele haben sich mit fundierten Vorschlägen eingebracht – ohne Gehör. Eine Reform, die nicht auf Augenhöhe diskutiert wird, kann nicht im Sinne einer solidarischen GEMA stehen.
Statt die bestehenden Stärken der Wertung E weiterzuentwickeln, droht mit Antrag 22a eine Spartenkultur verloren zu gehen, die seit Jahrzehnten wichtige künstlerische Entwicklungen möglich macht. Es braucht ein neues Verfahren, das alle einbezieht – E wie U –, mit dem Ziel, ein transparentes, gerechtes und zukunftsfähiges Modell zu entwickeln.
Ich spreche mich daher klar gegen den Antrag in seiner jetzigen Form aus.
Ludwig Wright (Vorstandsmitglied)
 Die historische Tragweite der GEMA-Reform ist enorm. Ich finde es gut, die Begriffe „Ernste und Unterhaltende Musik“ zu überwinden. Sie sind anachronistisch und keine hilfreiche Kategorisierung des Musikschaffens.
Die historische Tragweite der GEMA-Reform ist enorm. Ich finde es gut, die Begriffe „Ernste und Unterhaltende Musik“ zu überwinden. Sie sind anachronistisch und keine hilfreiche Kategorisierung des Musikschaffens.
Der Abschaffung der kollektiven Verteilung in der Sparte E kann ich argumentativ folgen, vor allem weil es transparenter und nachvollziehbarer sein kann, die Verteilung und Förderung zu trennen. Der KUK-Zuschlag ist werkabhängig und soll als Ersatz der kollektiven Verteilung dienen. Das 150 €-Mindestaufkommen ist für mich unproblematisch. Es gibt oft Mindestvoraussetzungen in der GEMA, bei denen man bereits semi-professionell Musik schaffen muss, um beteiligt zu werden.
In der Wertung wird weiterhin das Gesamtschaffen vom Wertungsausschuss belohnt. Ich finde es gut, dass Rechtsnachfolger:innen nicht mehr beteiligt werden. Kompositionen von lebenden Urheber:innen sollen direkt gefördert werden, statt Systeme zu füttern, die auf Gutwillen Kompositionsaufträge an einen kleinen Kreis vergeben.
Der Fokus-Kultur-Ausschuss ist ein demokratisches Gremium mit Transparenzpflicht gegenüber der Mitgliedschaft. Dieser bestimmt Kriterien für eine Kulturförderung und entscheidet nicht über einzelne Werke oder Genres. Das ist viel besser als eine intransparente und unklar besetzte erweiterte Verteilungsplankommission.
Natürlich kann eine so große Reform nicht alles umfassen. Es gibt viel Gestaltungsspielraum bei der dynamischen Fokus-Kulturförderung und der Einzelförderung. Wir müssen uns alle informiert einbringen. Debatten gehören zum demokratischen Prozess, genauso wie Kompromissbereitschaft, aber ohne Polemik mit klaren Ansagen.
Peter W. Schmitt (Vorstand DEFKOM)
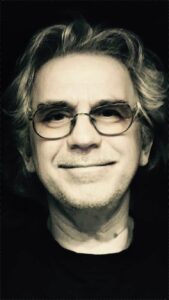 Das Reformvorhaben, der GEMA Antrag 22a ist ein Jahrhundertprojekt mit dem Ziel, die nicht mehr zeitgemäße Unterteilung von E- und U-Musik in eine modernere Form der Kulturförderung zu überführen.
Das Reformvorhaben, der GEMA Antrag 22a ist ein Jahrhundertprojekt mit dem Ziel, die nicht mehr zeitgemäße Unterteilung von E- und U-Musik in eine modernere Form der Kulturförderung zu überführen.
Die Komposition von Filmmusik ist eine eigenständige Kunstform. Sie schafft emotionale Tiefe, rhythmisiert die Dramaturgie und verleiht Szenen eine zusätzliche Bedeutungsebene. Dabei kennt die Filmmusik keine stilistischen Grenzen: Von klassischem Orchester über elektronische Klanglandschaften bis hin zu zeitgenössischer Avantgarde. Alles ist möglich, wenn es dem filmischen Ausdruck dient.
Filmmusikkomponist:innen müssen sich daher in unterschiedlichsten musikalischen Idiomen bewegen können. Die Herausforderung besteht darin, Musik zu schreiben, die sich nahtlos in die visuelle Sprache des Films einfügt und eigenständig wirkt.
Besonders spannend ist die Integration zeitgenössischer Musik in den Film. Kompositionstechniken wie Cluster, aleatorische Elemente oder Mikrotonalität können gezielt eingesetzt werden, um emotionale Ambivalenz, psychologische Spannungen oder abstrakte Atmosphären zu erzeugen. Gerade in experimentellen oder künstlerisch ambitionierten Filmprojekten findet diese Klangsprache ihren Platz. Motive und Klangfarben die im Verlauf des Films variieren und sich weiterentwickeln können sind vergleichbar mit einer sinfonischen Struktur.
Moderne Filmmusik nutzt diverse digitale Werkzeuge und hybride Orchestrierung, um komplexe Klangwelten zu erschaffen. Doch unabhängig von der technischen Umsetzung bleibt eines entscheidend: die emotionale Wirkung.
Die Offenheit für verschiedenste musikalische Ausdrucksformen, auch abseits der traditionellen Tonalität, ist daher keine Option, sondern eine Notwendigkeit für alle, die sich ernsthaft mit der Komposition von Filmmusik beschäftigen.
Der Film selbst kennt keine stilistischen Grenzen, warum sollte es die Musik tun?
Wir denken deshalb, dass die Unterscheidung zwischen sogenannter Ernster Musik (E-Musik) und Unterhaltungsmusik (U-Musik) ein Konzept ist, das zwar im deutschsprachigen Raum eine historisch bedingte Tradition hat, aber schon lange nicht mehr trägt.
Die jetzt anstehende GEMA-Reform ist hier überfällig und fasst die Kategorien der förderwürdigen Musik wesentlich weiter. Somit besteht die Chance, dass weit mehr Kompositionen aus zeitgenössischer Musik, Jazz, ambitionierter Filmmusik, Rock etc. gefördert werden können als bisher.
Zudem wird die Förderung, wie sie der Antrag 22a vorsieht, zum ersten Mal transparent und nachvollziehbar.
Wir sind sehr an einer konstruktiven und solidarischen Auseinandersetzung interessiert, damit die Voraussetzungen für kreatives Schaffen aller erhalten bleiben oder verbessert werden.
Schieflagen müssen sachlich betrachtet und korrigiert werden.
Die Schere zwischen Nutzung/Ausschüttung und Wertung in der E-Musik geht zu weit auseinander. Wir sollten nicht so lange warten, bis Regulierungen und Klagen gegen die GEMA ins Haus stehen. Jede Klage schwächt die GEMA auch in anderen Belangen. Eine starke GEMA im internationalen Kontext ist für uns alle bei den aktuellen Herausforderungen und in der Zukunft wichtig.
Wir halten am Solidargedanken aller Urheber in der GEMA fest. Der 10%-Abzug für soziale und kulturelle Zwecke bleibt erhalten. 30% davon gehen als Förderung an kulturell hochwertige Werke.
Bei allen Differenzen sollten wir im Blick behalten, dass wir nur handlungsfähig bleiben, wenn wir die notwendigen Reformen selber gestalten, bevor wir die Regeln von außen gesetzt bekommen.
Alexander Strauch (Vorstand FEM)
 Den Gedanken zur Reform der Sparte E finden wir grundsätzlich wichtig und gut. Deshalb haben wir uns bereits in der Vergangenheit Gedanken zu Veränderungen in der Verteilung und Förderung / Wertung E gemacht und diese über unsere Sachverständigen im Programmausschuss E eingebracht. Leider erfolgte hierauf keine Reaktion. Dabei ist uns sehr daran gelegen, dass nicht nur die E-Musik, sondern auch andere förderungsbedürftige und förderungswürdige Werke und Leistungen berücksichtigt werden.
Den Gedanken zur Reform der Sparte E finden wir grundsätzlich wichtig und gut. Deshalb haben wir uns bereits in der Vergangenheit Gedanken zu Veränderungen in der Verteilung und Förderung / Wertung E gemacht und diese über unsere Sachverständigen im Programmausschuss E eingebracht. Leider erfolgte hierauf keine Reaktion. Dabei ist uns sehr daran gelegen, dass nicht nur die E-Musik, sondern auch andere förderungsbedürftige und förderungswürdige Werke und Leistungen berücksichtigt werden.
Dazu müsste nicht nur die Wertung E, die ca. 30 % der gesamten Wertungsmittel zugewiesen bekommt, sondern auch die um mehr als 2/3 höheren Wertungsmittel U reformiert werden, denen 70% der Wertungsmittel zugewiesen werden, denn diese könnte dann besonders für eine bessere und zielgenauere Förderung der U-Musik als heute mit ihren hohen Einstiegshürden im Vergleich zur Wertung E sorgen.
Die jetzt mit Antrag 22a vorgestellten Pläne zur „Verteilung und Förderung für zeitgenössische Kunstmusik und Reform der kulturellen Förderung der GEMA“ lehnen wir allerdings ab. Wir fordern, den Antrag aufzuschieben und in einer von der GEMA berufenen paritätisch besetzten Arbeitsgruppe aus Vertreter:innen der Verbände der E- und U-Musik grundlegend von Anfang an zu besprechen und damit die Teilhabe am Diskussionsprozess der Minderheit der E-Musik zu garantieren. Komponist:innen der E-Musik und ihrer Verbände waren nämlich seit Juni 2024 nicht mehr z.B. über den Programmausschuss E am Reformvorhaben beteiligt.
Hauptkritikpunkte sind neben der Frage der Teilhabe am Findungsprozess die Pläne zur Verteilung und zur Förderung. Die geplante Direktverteilung lehnen wir ab und favorisieren eine reformierte und vereinfachte kollektive Verteilung. Bisher partizipierten auch durch den Werkausschuss nach § 65 eingestufte Werke und Kolleg:innen des Jazz u.a. an der Sparte E. Eine weitere Öffnung hätten wir begrüßt und gerne nachhaltig im Findungsprozess begleitet.
In der geplanten KUK-(„Kunstmusikkonzert“)-Förderung werden wieder problematische Stufen für die Punkte der Werkdauer mit denselben Problemen verwendet wie in der bisherigen Verteilung. Zudem befürchten wir, dass die KUK-Förderung viel weniger „aktives“ Repertoire als die heutige Wertung E fördert. Das Werk wird uns zudem viel zu wenig als im aktuellen System berücksichtigt, Einkommensschwankungen werden nicht mehr ausgeglichen. Statt die Wertung E selbst grundlegend zu reformieren, ihre guten Ansätze zu transformieren und Verzerrungen aufzuheben, soll sie komplett abgeschafft werden.
Auch lehnen wir die radikal reduzierte Mittelzuweisung ab, weil wir auch damit befürchten müssen, dass nur noch eine kleine dreistellige Zahl an Berechtigten in der KUK-Förderung beteiligt sein wird. Zuletzt lagen uns bis heute keine beispielhaften Modellrechnungen von unterschiedlichen Fallbeispielen vor, die individuelle mögliche Verluste oder Veränderungen zwischen E und KUK aufzeigten.
Wie eingangs und im Weiteren dargestellt sind wir jederzeit für Reformen und Dialog offen. Dazu muss unsere Sparte im Prozess allerdings angemessen beteiligt werden. Jetzt haben wir leider den Eindruck, dass fast keine einzige unserer Forderungen angemessen berücksichtigt wurde und die Sparte E zu nahezu 100% gegen den Willen der Betroffenen durch ein System mit vielen offenen Fragen ersetzt wird. Es wäre zielführender, wenn mit der Sparte E gemeinsam grundlegende Veränderungen diskutiert und beschlossen werden.
Daniel Flamm (Vorstand VERSO)
 Die Musik-Welt befindet sich in einem stetigen und radikalen Wandel. Ich als Songwriter, Produzent und Manager beobachte und erlebe fast täglich, wie Genregrenzen verschwimmen, neue Vertriebswege entstehen und sich die Rolle von Musik in unserer Gesellschaft neu definiert. Umso wichtiger ist es, dass auch Institutionen wie die GEMA diese Entwicklungen anerkennen und ihnen gerecht werden.
Die Musik-Welt befindet sich in einem stetigen und radikalen Wandel. Ich als Songwriter, Produzent und Manager beobachte und erlebe fast täglich, wie Genregrenzen verschwimmen, neue Vertriebswege entstehen und sich die Rolle von Musik in unserer Gesellschaft neu definiert. Umso wichtiger ist es, dass auch Institutionen wie die GEMA diese Entwicklungen anerkennen und ihnen gerecht werden.
Ich selbst habe über viele Jahre Musik gemacht, die sich in subkulturellen Szenen und Nischen-Genres bewegt hat – abseits des Mainstreams, aber nicht weniger bedeutungsvoll für eine lebendige Musik-Szene. Gerade aus dieser Erfahrung heraus begrüße ich die aktuellen Reformbestrebungen der GEMA ausdrücklich: Es ist überfällig, dass auch diese vielfältigen, oft marginalisierten Genres der sogenannten „U-Musik“ eine faire Chance auf Förderung und Anerkennung erhalten.
Die bisherige Unterscheidung zwischen U- und E-Musik wirkt heute anachronistisch. Sie entspricht nicht mehr der Realität einer dynamischen Musikszene, die völlig gemischt, vernetzt und stilistisch frei arbeitet. Viele kreative Stimmen finden sich in dieser alten Struktur nicht wieder – und werden dadurch benachteiligt.
VERSO setzt sich für eine Musiklandschaft ein, die Vielfalt abbildet – frei, fair, transparent und offen für Innovation. Eine GEMA, die mit der Zeit geht, ist dafür ein zentraler Baustein. Es ist wichtig, dass wir die Musikszene verantwortungsvoll gestalten, um mit der Zeit zu gehen und die Talente neuer Generationen zu fördern, weshalb wir von VERSO ganz klar empfehlen für den Antrag 22a der GEMA-HV zu stimmen.

